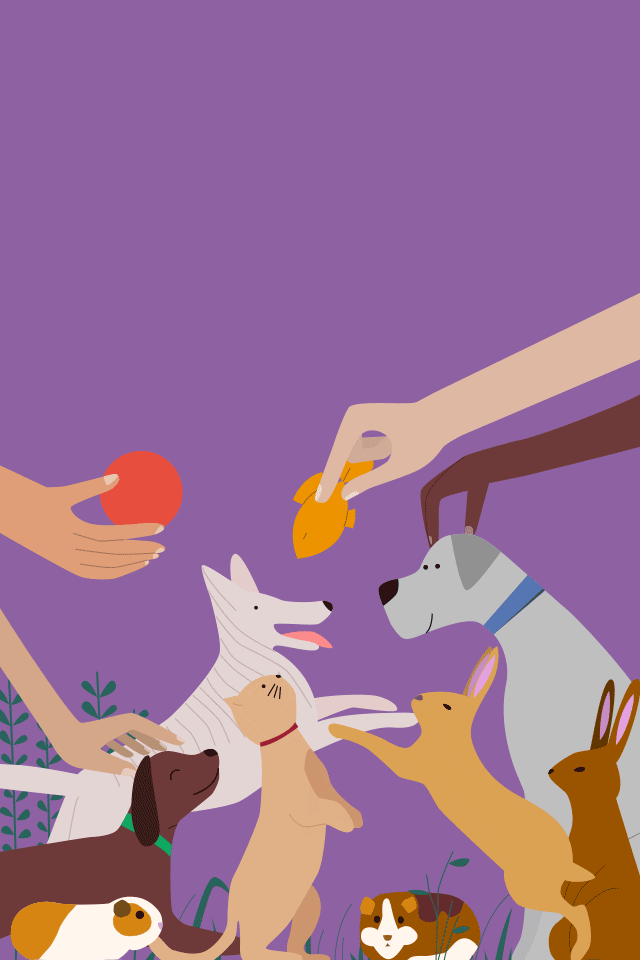Hautpilz beim Meerschweinchen: wenn kahle Stellen zum Problem werden [11|21]
Krankheit, Hautpilz, Juckreiz, Immunsystem, Zoonose, Ansteckung, Umgebungskontamination – News [09|11|21]
- Wenn sich Meerschweinchen ständig kratzen und kahle Stellen zu sehen sind, kann die Ursache ein Hautpilz sein.
- Tiere mit geschwächtem Immunsystem sind häufiger betroffen
- Circa 8,5% der Meerschweinchen sind Trägertiere ohne merkbare Symptome
- Hautpilz kann vom Meerschweinchen auf den Menschen übertragen werden
- Die Pilzsporen bleiben in der Umwelt bestehen
Relativ häufig kommt es bei unseren Meerschweinchen zu Pilzerkrankungen der Haut. Meist fällt zuerst eine kahle Stelle im Fell des Tieres auf, oft wird zusätzlich auch Juckreiz beobachtet. Ob von erkrankten Tieren oder mit Sporen behafteten Gegenständen ist die Ansteckbarkeit mit Hautpilzerkrankungen, sowohl bei anderen Tieren als auch beim Menschen, gegeben.
1. Wie sich eine Pilzinfektion zeigt:
- Schuppige, wunde und/oder nässende Kahlstellen
- Juckreiz
- Hautveränderungen am häufigsten am Kopf - vor allem um Nase, Maul, Augen und/oder Ohren
- schweren Erkrankungen mit Ausweitung auf den Rücken und die Gliedmaßen
- Hautveränderungen am Bauch und Erkrankungen der Krallen sind möglich
Nicht jedes infizierte Tier zeigt Symptome. Etwa 8,5% sind symptomlos, können aber dennoch als Überträger infrage kommen.
2. Wie eine Pilzerkrankung entsteht:
- Pilzsporen bleiben im Fell haften
- Durch Kontakt zu Keratinozyten keimen die Sporen aus
- Pilz bildet Hyphen aus, die in die oberste Epidermisschicht eindringen und ein Myzel schaffen
- Die gebildeten Produkte lösen im Trägertier entzündliche Reaktionen aus
3. Erhöhte Ansteckungsgefahr:
- Geschwächtes Immunsystem
- Stress
- Warmfeuchte Umgebung
- Schlechte Hygienebedingungen, beispielsweise durch seltenes Ausmisten
- Genetische Faktoren
- Haltungs- und Fütterungsfaktoren wie zu wenig Platz oder Mangelernährung
- Ektoparasitenbefall
4. Diagnose einer Pilzinfektion:
- Gewonnene Haarprobe wird auf einem Nährboden angezüchtet oder
- Die Probe wird mittels PCR-Verfahrens analysiert
- Die Woodsche Lampe ist nur wenig aussagekräftig, da die häufig vorkommenden Pilzarten keine Fluoreszenz zeigen
- Häufigster Erreger einer Pilzinfektion beim Meerschweinchen ist T. (Trichophyton) mentagrophytes (97%), gefolgt von anderen Arten wie M. (Microsporum) gypseum (3%), M. canis (3%), T. terrestre (0,9%), M. equinum (0,2%) sowie M. audouinii (0,2%)
5. Behandlung:
- Lokale Therapie mit antimykotischen Salben, Cremes und Tropfen
- Oral eingegebene Antimykotika
- Verwendung antimykotischer Shampoos und Waschlösungen
- Eventuell Schur bei langhaarigen Tieren, jedoch besteht die Gefahr von Mikrotraumen
- Umgebungsdesinfektion
Die Therapie sollte noch bis zu zwei Wochen nach Abklingen der Symptome fortgeführt werden, da sich die Infektion ansonsten wieder ausbreiten kann.
6. Zusammenfassung:
Hautpilzerkrankungen treten beim Meerschweinchen relativ häufig auf. Besonders gefährdet sind bereits geschwächte Tiere. Die Behandlung muss gründlich erfolgen, da Pilzsporen längere Zeit in der Umwelt überdauern können. Durch Kontakt mit erkrankten Tieren, auch wenn sie keine Symptome zeigen, können sich andere Tiere und Menschen anstecken.
Wenn Du gut findest, was wir machen, dann unterstütze uns!
Du hast gerade einen Artikel auf unserer Seite gelesen oder nach Hilfe gesucht? Unsere Infos und Tipps haben Dir geholfen? Du weißt jetzt, was Dein Vierbeiner braucht? Das hoffen wir!
Deshalb machen wir Petdoctors. Weil mehr Wissen über Gesundheit und Verhalten unserer Vierbeiner, Hund Katze & Co ein besseres Leben verschafft.
Wir möchten unsere Infos weiter kostenlos und ohne nervige Werbung anbieten. Dafür brauchen wir Deine Unterstützung. Jeder Beitrag hilft:
Du kannst den Spendenbetrag und die Häufigkeit der Spenden selbst bestimmen.
- 5 €
- 10 €
- 20 €
- Anderer Betrag
Du kannst auch entscheiden, ob Du einmalig oder regelmäßig spenden möchtest.
Du willst uns lieber direkt unterstützen? Unser Support-Konto lautet:
Petdoctors
IBAN: AT49 1100 0124 4251 4100
BIC: BKAUATWW
PETdoctors ist das wikiPETia für PETlovers * mehr als 2.000.000 User:innen informieren sich auf petdoctors und täglich werden es mehr * jeden Tag ein neuer Artikel, eine Petdoctors-, Pettrainers- und Tierspitalsuche für Notfälle * ein Newsletter * alles kostenlos & werbefrei.
Damit Du schneller findest, was Du suchst.
![Hautpilz beim Meerschweinchen: wenn kahle Stellen zum Problem werden [11|21] petdoctors.at, Krankheit, Hautpilz, Juckreiz, Immunsystem, Zoonose, Ansteckung, Umgebungskontamination](/pictures/W1siZiIsIjIwMjEvMTEvMDcvNTVocWU5YjI2cF9KdWNrcmVpel9NZWVyc2Nod2VpbmNoZW5fTGl2aWFfY19Ob3Zha292YV9hdWZfUGl4YWJheV9BLmpwZyJdXQ/Juckreiz%20Meerschweinchen%20Livia%20%28c%29%20Novakova%20auf%20Pixabay%20%20A.jpeg?image_size=900x500&basename=Juckreiz+Meerschweinchen+Livia+%28c%29+Novakova+auf+Pixabay++A&sha=65ff8f19617fa8d5)